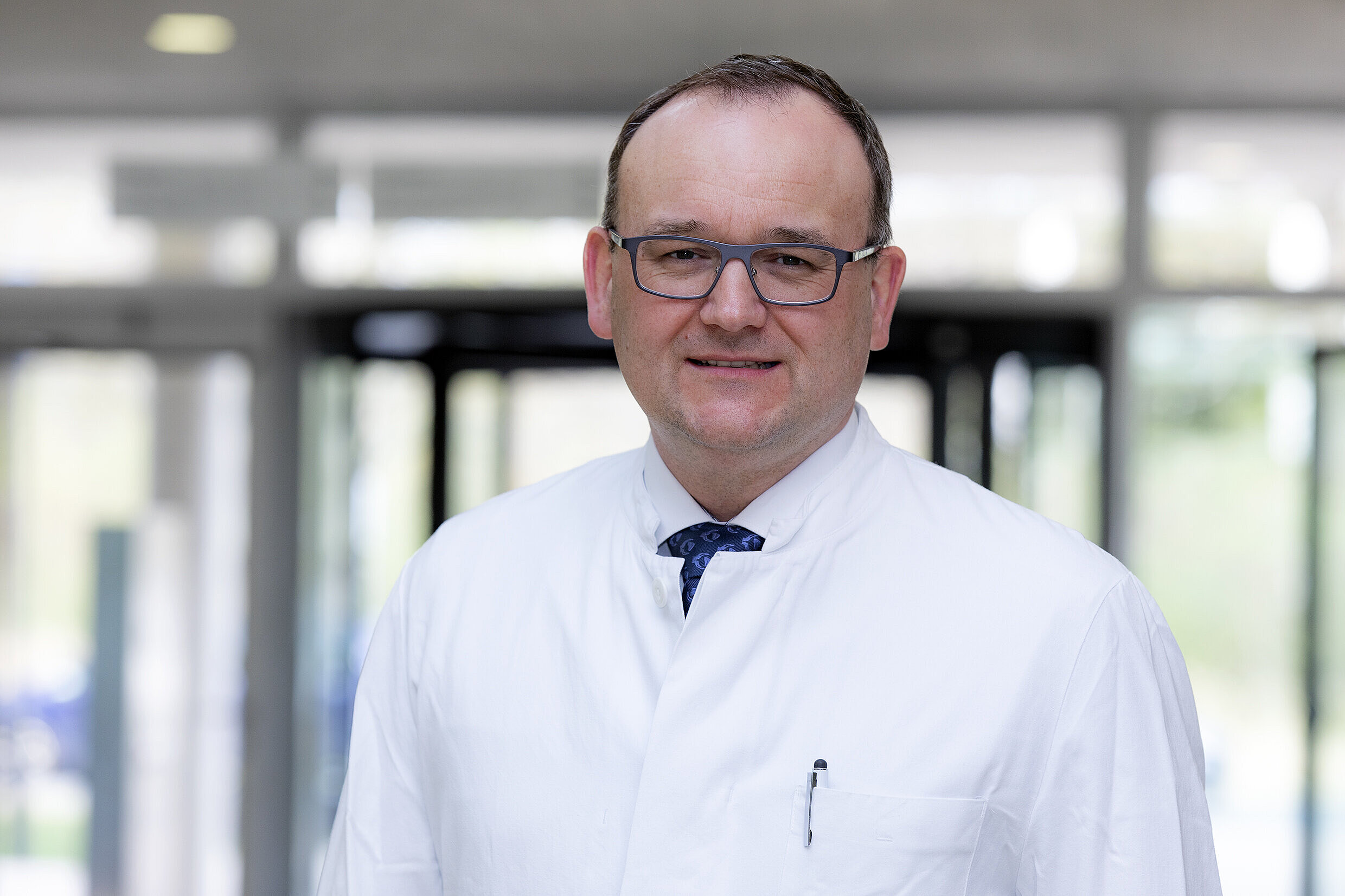Sie sind gleichzeitig klinischer Direktor des HZI. Welche Aufgaben sind damit verbunden?
So genau lassen sich die Aufgaben gar nicht von denen des CiiM-Direktors trennen. Für beide Seiten muss ich herausfinden, zu welchen relevanten Infektionsthemen wir Arbeitsgruppen der MHH und des HZI zusammenbringen können, um bestimmte Aspekte der Infektionsmedizin zu erforschen. Dazu führe ich derzeit viele Gespräche, in denen ich zusammen mit HZI-Forschern überlege, welche Möglichkeiten sich aus den vielen verfügbaren Patientendaten der MHH ergeben und welche laufenden Patientenstudien sich durch Einbindung des HZI auf eine höhere Ebene heben lassen.
Gibt es schon konkrete Beispiele?
Ja, wir haben einige Ideen gesammelt und erste Projekte auf den Weg gebracht. So haben wir zum Beispiel einen Wissenschaftler aus der HZI-Abteilung von Michael Meyer-Hermann in ein Projekt mit Hepatitis B-Patienten eingebunden. Hepatitis B lässt sich nicht heilen, mit einer Therapie aber eindämmen. Bei manchen Patienten bricht die Infektion nach Absetzen der Therapie wieder aus, bei anderen nicht. Mithilfe einer Software aus dem Meyer-Hermann-Labor, die maschinelles Lernen nutzt, konnten wir nun ein Set aus Signalstoffen identifizieren, mit dem sich für jeden Patienten mit über 90-prozentiger Sicherheit vorhersagen lässt, was nach Absetzen der Hepatitis B-Therapie passiert. Mit Karsten Hillers Forschungsgruppe vom BRICS planen wir ein Programm zur Untersuchung von Nebenwirkungen einer Hepatitis C-Therapie. Und auch mit Carlos Guzmán vom HZI erarbeiten wir gerade ein Projekt mit individualisiertem Ansatz: Daten aus Kohortenstudien haben gezeigt, dass Patienten mit Leberzirrhose schlechter auf Grippeschutzimpfungen ansprechen als gesunde Patienten. Nun wollen wir gemeinsam den Zusammenhang erforschen. Neben meinen neuen Kooperationen gibt es natürlich schon zahlreiche weitere Kooperationen zwischen Arbeitsgruppen der MHH und des HZI.
Noch ist das CiiM ein virtuelles Zentrum. Welche Herausforderungen sind damit verbunden?
Es fehlt einfach ein zentrales Gebäude, in dem die zwingend erforderliche Interdisziplinarität gelebt wird und man sich an der Kaffeemaschine austauschen kann. Für mich heißt virtuelles Zentrum derzeit: viele Fahrten zu den Partnern und viel Organisatorisches zur Realisierung einer Zusammenarbeit. Auch wird das eigene Gebäude wichtig, um neue Technologiestandards umzusetzen – und als Zeichen der Bedeutung des Zentrums. Viel wichtiger sind mir aber die Projekte, die wir schon auf den Weg gebracht haben und die wir gerade anstoßen. Laufende Projekte sind allemal besser als ein leeres Gebäude ohne Projekte.
Wann soll aus dem virtuellen denn ein physisches Zentrum werden?
Der Spatenstich könnte schon 2020 erfolgen und das Gebäude noch in den frühen 2020er Jahren stehen. Dann hätten wir Platz für rund 150 Mitarbeiter.
Wie würden Sie die langfristigen Ziele des CiiM beschreiben?
Beim Ansatz der Individualisierung geht es darum, die für einen Patienten am besten geeignete Prophylaxe oder Therapie auswählen zu können. Wir suchen in Patientendaten nach Eigenschaften – bestimmten Markermolekülen –, anhand derer wir die Patienten in verschiedene Gruppen einteilen und so für jede Gruppe eine angepasste Therapieentscheidung treffen können. Das Ziel ist, schon vor dem Beginn einer Therapie festzustellen, welche Patienten zum Beispiel nicht darauf ansprechen würden, welches Antibiotikum am besten geeignet wäre oder ob eine Impfung die gewünschte Immunantwort auslösen würde.
Haben Sie vor, am CiiM auch mit Patienten zu arbeiten?
Das kann ich mir gut vorstellen, zum Beispiel in einer eigenen kleinen Ambulanz. Als Möglichkeit des CiiM sehe ich auch einen klinischen Beratungsservice: Wenn eine Klinik bei einem Patienten nicht weiterkommt, weil er auf keine Therapie anspricht – oder beim genauen Gegenteil, einer außergewöhnlich guten Heilung –, könnten wir den Patienten weiter begleiten und auf verschiedene Marker testen. Vielleicht finden wir so mit unseren Methoden heraus, warum dieser Patient eine besondere Stellung hat. Natürlich müssten die Patienten dem zustimmen, allein aus Gründen des Datenschutzes.
Neben Ihren Verpflichtungen am CiiM und HZI sind Sie auch noch leitender Oberarzt an der MHH und Professor für klinische Infektiologie mit eigener Arbeitsgruppe am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Müssen Sie sich manchmal fragen, welchen Hut Sie gerade aufhaben?
Stimmt, das ist nicht immer einfach. (lacht) Vieles überschneidet sich. Mein Chef hat immer gesagt, ein Tag habe 24 Stunden und noch die Nacht dazu. Ich habe aber exzellente Mitarbeiter, die mir gerade in der Klinik viel abnehmen. Sie sind für mich das A und O. Meine vielfältigen Aufgaben sind aber genau das, was ich immer machen wollte. Die Infektionsmedizin hat mich schon seit meiner Doktorarbeit gereizt, und individualisierte Forschungsansätze verfolge ich seit meiner Postdoc-Zeit an der University of Massachusetts Medical School in den USA. Wichtig ist mir auch, dass ich nicht nur Forschung betreibe. Gerade der Patientenbezug wie durch die tägliche Visite in der Klinik macht die Medizin so abwechslungsreich.
Für viele HZI-Beschäftigte sind Sie ein neues Gesicht – erzählen Sie mal: Wer ist Markus Cornberg?
Tja, wer ist Markus Cornberg … (lacht) Ich bin verheiratet, und wir haben zwei Jungen, 13 und neun Jahre alt. Unser älterer Sohn ist begeisterter Schwimmer, der jüngere spielt Basketball – wir sind dadurch an den Wochenenden viel unterwegs. Früher habe ich selbst Handball gespielt, das schaffe ich jetzt aber nicht mehr. Für einen „Norddeutschen“ ungewöhnlich, fahre ich jedes Jahr nach Köln zum Karneval, regelmäßig schon seit 1999. Ursprünglich komme ich nämlich aus Hessisch Oldendorf im Weserbergland, der früheren norddeutschen Karnevalshochburg – daher bin ich mit dem Karneval aufgewachsen.
Autor: Andreas Fischer
Veröffentlichung: Mai 2019